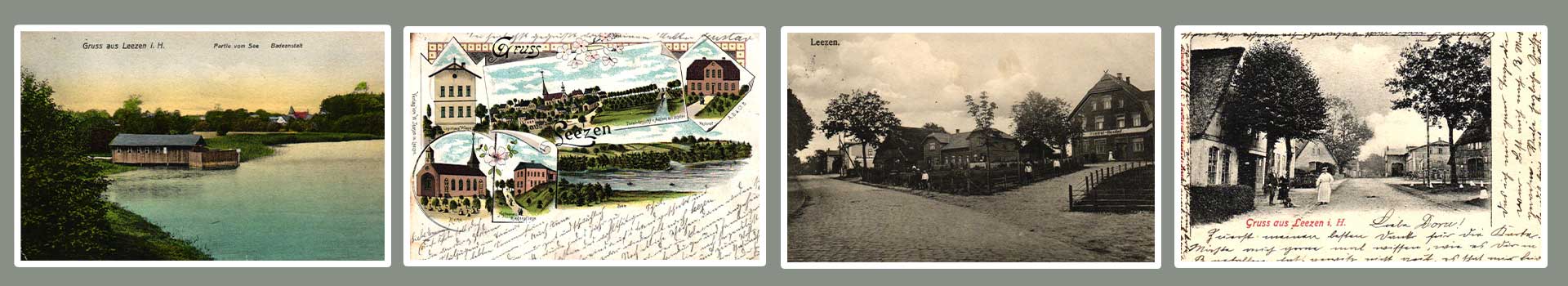Leben an der Trave im 11. und 12. Jahrhundert

Leezen gilt als eines der ältesten holsteinischen Dörfer. Der ursprüngliche Name Latzinghe deutet auf eine Alt-Sächsische Gründung an der Grenze zwischen germanischem und slawischem Siedlungsgebiet nördlich der Elbe. Am Ende der Völkerwanderung war das Land fast menschenleer. Außer Holsten (Holsaten, Holtsassen) siedelten sich an der Trave auch Stormarner an. Östlich der Trave, vor allem an der Ostseeküste siedelten seit dem frühen Mittelalter Wagrier, ein Stamm der Abodriten. Dieser Name wird im 10. Jahrhundert von Widukind von Corvey erstmals als Waari, aber auch Waigri erwähnt. Der Ursprung ist nicht slawisch. Es ist ein altnordischer Name, der mit „Buchtanwohner“ übersetzt werden kann. Leezens Nachbardörfer im westlichen Grenzgebiet des Limes Saxoniae an der Trave waren germanische und auch slawische Gründungen. Wann entstanden die Siedlungen? Wie war das Zusammenleben?
Peter Rohde
August 2020 / Januar 2022
Vorwort
Über die Geschichte von Leezen wird in Dorfchroniken seit 150 Jahren berichtet und Kirchenbücher dokumentieren das Geschehen seit fast 400 Jahren. Wenig überraschend nehmen Berichte über die Entwicklung der bäuerlichen Gesellschaft breiten Raum ein. Da die Kirche Träger des gesellschaftlichen und schulischen Lebens war finden wir hierzu sehr viele Informationen. Wenig wissen wir über das Zusammenleben mit den slawischen Mitmenschen an der Trave. Erste amtliche Dokumente zur frühen Dorfgeschichte finden wir ab dem 12. Jahrhundert. Durch die Zerstörung des Dorfes im 30-jährigen Krieg sind viele Informationen verloren gegangen. Lokale Informationen über die Zeit vor der Reformation sind spärlich. Erst ab dem 17. Jahrhundert wurden Kirchenbücher kontinuierlich geführt und es wurden die Grundbücher eingeführt und geben Auskunft über die Ländereien und deren Eigentümer. Seit dieser Zeit ist unsere Geschichte gut dokumentiert. Über unsere Nachbarn wissen wir vergleichsweise weniger. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen und On-line Bibliotheken und andere Quellen eröffnen die Möglichkeit die Geschichte Leezens und auch das regionale Umfeld und die Geschichte unseres Dorfes im holsteinischen und wendisch slawischen Umfeld besser zu verstehen. Die Herkunft der Holsteiner liegt im Dunkeln. Der ursprüngliche Name ist „Holtsassen“, wörtlich „Holzbewohner“, was angesichts der riesigen Urwälder plausibel ist. Der Stammessitz der Holsten befand sich im Raum des heutigen Neumünster an der Stör und am Ochsenweg. Es bestand neben der Landverbindung auch ein Wasserweg zur Elbe. Im Verlauf der Besiedelung Holsteins spielte seit der Völkerwanderung der „Ochsenweg“ als Fernhandelsroute und später als Gaugrenze eine wichtige Rolle.
„Dieser Weg war keine Straße im heutigenSinne, die mit einer Trasse von A nach B führte, sondern bestand aus einem Bündel von Wegen von Viborg bis zur Elbe bei Hamburg. Das System lag auf der Geest. Die Wege waren fast ausnahmslos unbefestigt und daher im Sommer staubig und sandig, in der kalten Jahreszeit morastig, grundlos und häufig unpassierbar. Von Hamburg und der Elbe aus führten durch Holstein eine Route über Itzehoe und eine über Neumünster nach Rendsburg.“
Quelle: www.geschichte-sh.de
Ein zentraler Handelsknotenpunkt war schon im frühen Mittelalter Itzehoe (alt-sächsisch: ochoho) nahe der Burg Esesfeld an der Stör. Dort kreuzten sich mehrere Handelswege mit dem Nord-Süd „Heerweg“ (Ochsenweg). Nach Süden führte ein Wasserweg über die Stör zur Elbe, nach Norden gab es eine Verbindung über die Stör nach Kellinghusen und weiter nach Wittdorf (Neumünster). Von Kellinghusen gab es einen Abzweig nach Osten über die Bramau nach Hitzhusen (Bad Bramstedt) und dann etwa entlang der heutigen B 206 bis Hageristorpp (Högersdorf), einem „Grenzübergang“ nach Wagrien. Jenseits der Trave lag die Ohlsburg, eine kleine Grabenburg aus dem 10. Jahrhundert.

So bestand schon im Frühmittelalter über Land und die Wasserwege Stör, Bramau und Trave eine durchgehende Verkehrsverbindung von der Elbe zur Ostsee. Durch Funde ist belegt, dass es zwischen den Nordelbiern und Slawen schon lange Handelsbeziehungen gab. Mit Gründung der Hanse 1150 wurde der Ost-West-Handelsweg als Lübsche Trade zur Nordsee verlängert. Zu Beginn der Besiedelung im Frühmittelalter war das Zusammenleben der Holsaten und Stormarner mit den Wenden verträglich. Man berührte sich kaum. Auf dem slawischen Gebiet, östlich der Trave, gab es seit der Karolinger Zeit mehr Siedlungen als im sächsischen Nordelbien. Wir wissen sehr wenig über das Zusammenleben der „Leezener“ mit den Slawen. Die Dörfer in unserer nachbarschaftlichen Umgebung zwischen Bornhöved und Oldesloe sind Germanische und auch Slawische Gründungen. Sie sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Es gibt nur wenige frühe mittelalterliche Gründungen an der Trave. Dazu gehört auch Leezen. Um mehr über die Geschichte unseres Dorfes im Mittelalter zu erfahren habe ich in Forschungsergebnissen namhafter Historiker und in Internetquellen recherchiert. Der Anhang bietet meine Auswahl an Quellen. Mein Resümee nach deren Studium ist allerdings sehr gemischt. Es gibt große Widersprüche bei der Darstellung von geschichtlichen Ereignissen, Namen, Orten, Zeiten, graphischen Darstellungen und deren Bewertung. Es sind oftmals handwerkliche Fehler, Übersehen und Auslassen von Fakten, unterschiedliche Beurteilungen. Besonders irritierend ist die Verwendung von Ortsnamen die zu den angegebenen Zeiten nicht passen, z.B. Segeberg oder Oldesloe in Darstellungen des 11. Jahrhunderts. Das erleichtert die Orientierung ist aber falsch.
Leezen und die Slawen im Limes Grenzgebiet an der Trave
Die Geschichte unseres Dorfes liegt über lange Perioden des Mittelalters im Dunkeln. Die örtliche Geschichte wurde erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts kontinuierlich aufgezeichnet und bewahrt. Es blieben zwar einige lokale Aufzeichnungen aus früherer Zeit erhalten, vieles ist mit den Zerstörungen des 30-jährigen Krieges verloren gegangen oder befindet sich den Archiven der katholischen Kirche. Die kleinen und großen Geschehnisse im Dorf wurden in das Kirchenbuch eingetragen. Die Namen einiger Pastoren vor dem 16. Jahrhundert sind überliefert. Erst Hinrich Hartung, Pastor von 1637 – 1686, begann die Geschehnisse in der Gemeinde fortlaufend aufzuschreiben. Die Namen aller Pastoren und Lehrer und die Zeit ihrer Tätigkeit sind aus den Kirchenbüchern seither bekannt. Es wurden dort nicht nur die standesamtlichen und schulischen Ereignisse erfasst, sondern auch viele kleine Begebenheiten des Alltagslebens. Die Kirchenbücher befinden sich im Original und vollständig im Kirchen-Archiv in Bad Segeberg. In unserem Gemeindearchiv verwahren wir das Findbuch dazu. Weitere Informationen über unser Dorf stammen aus anderen Urkunden und Berichten, dem Landesarchiv und den Landesmuseen in Schleswig. Im Schrifttum findet man eine der bedeutendsten zeitnahen Quellen über Holsteins mittelalterliche Geschichte, die Chronica Slavorum von Helmold von Bosau. Der Mönch dokumentiert bis etwa 1160 die oftmals sehr gewalttätigen Konflikte und ist einer der wenigen Chronisten die über die Zeitgeschichte in Stormarn, Holstein und vor allem dem Land der Wagrier berichten. Er dokumentierte auch das Wirken von Vizelin, dem späteren Bischof der das Kloster Segeberg (1134) gründete und mehrere (Felsstein-)Kirchen im Gebiet des heutigen Ost-Holstein errichtete.

Quelle: www. Geschichte-s-h.de
Nach dem Tod von Karl und mehreren Reichsteilungen entstand 870 das Ostfränkische-Reich. Es schloss auch Nordalbingien, das germanische Land nördlich der Elbe, ein. Nach weiteren Gebietsveränderungen entstanden 919 unter Heinrich I das „Regnum Teutonicum“ und 962 mit Otto I. das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“. In den darauf folgenden 200 Jahren waren im Norden die Menschen durch blutige Schlachten gebeutelt. Es ging um die Macht des Kaisers, des Papstes, das Deutsche Reich, die weltlichen und religiösen Fürsten, die zum großen Teil zwangsweise Christianisierung, Kriege mit den Slawen und Konflikte mit Dänen und Wikingern. Lothar III. von Supplingenburg war Herzog von Sachsen, Deutscher König und Römischer Kaiser bis zu seinem Tod 1137. Das Deutsche Reich war in Herzogtümer als (Lehens-) Verwaltungsbezirke des Kaisers aufgeteilt. Der nördlichste war Sachsen. Es reichte vom Niederrhein bis zur Eider. Das heutige Ostholstein lag außerhalb der Reichsgrenzen und gehörte zur Billunger Mark. Die war entlang der Osteeküste ein „Interessensgebiet“ des Reiches, ein altes Lehen an Hermann Billung. Sie war überwiegend von slawischen Stämmen bewohnt und in Nordelbien durch den von Karl festgelegten Limes Saxoniae von Germanien getrennt, der in der Karte als langer heller Streifen dargestellt ist. Im gesamten Raum zwischen Elbe, Eider, Nordsee und Ostsee, wohnten im 10. und 11. Jahrhundert etwa 400 000 Menschen: Sachsen, Holsaten, Stormarner, Dithmarscher und östlich des Limes zwei wendische Abodriten-Stämme. Die Wagrier siedelten östlich der Schwentine und Trave bis zum heutigen Oldesloe und die Polaben südlich der Trave an der Elbe. Sie hatten sich über einige hundert Jahre von jenseits der Oder über Vorpommern, Brandenburg und Mecklenburg verbreitet und auch an der Elbe und in Ostholstein angesiedelt. Von vielen Historikern werden die Slawen als angriffslustig und gewalttätig beschrieben. Sie hatten einen Ruf aggressive Piraten zu sein. Schon kurz nach der Völkerwanderung kamen Missionare in den Norden um die Menschen zum Christentum zu bekehren. Die Missionierungsversuche einzelner Wanderprediger waren nicht nachhaltig. Viele „Bekehrte“ machten nur zum Schein mit und beteten weiterhin ihre Götter an. Die „organisierte“ und nachhaltige christliche Missionierung begann erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts mit Kirchenbauten und Klostergründungen. Die Segeberger Kirche wurde als Holzbau begonnen und später mit Ziegelsteinen vollendet. Sie ist der älteste Rot-Ziegelbau in Nordelbien. Die Burgen waren Erdwälle, z.B Oldenburg, Nütschauer Schanze. Hier sei vergleichsweise erwähnt, dass in Aachen der Kaiserdom über 200 Jahre zuvor von Karl errichtet wurde und 1030 mit dem Bau der gewaltigen Kathedrale in Speyer begonnen wurde. Erst mit der Gründung der Hanse wurde die Rückständigkeit Nordelbiens allmählich beseitigt. Kiel entstand erst im 13. Jahrhundert.
Die Leezener Pfarrkirche
Eine treibende Kraft der Missionierung war der Augustinermönch Vizelin. Er kam um 1118 als Wanderprediger zuerst nach Bremen und dann nach Nordelbien. Viele Kirchen wurden von ihm in Wagrien erbaut. Eine der Bekanntesten ist in Bosau. Das Kloster und die Stiftskirche in Neumünster (novum monasterium) wurden 1127 im damaligen Wipenthorp von Vizelin gegründet. Er unterstand nicht dem Bischof in Hamburg sondern war als „Vice-Vikar“ vom Papst entsandt. Er stieg in der nordelbischen Kirche schnell auf und gründete in Starigard (Oldenburg) im Slawenland erneut den zuvor nach einer misslungenen Missionierung verlassenen Bischofsitz. Er hatte einen Ruf als durchsetzungsstarker Organisator. Als die Wagrier die zwangsweise Christianisierung zum wiederholten Mal mit Gewalt rückgängig machten, floh er nach Bosau und gründete die St. Petri Kirche. 1152 verstarb er in seinem Stift in Neumünster.
Er hat den Umbau der Leezener Kirche betrieben, so dass sie heute als Vizelin-Kirche gilt. Richard Haupt beschreibt 1884 in seinem Buch „Die Vizelinskirchen“ den Abriss der alten und den Neubau der Kirche von 1870 als „schlimmster Art“ und bedauert, dass die spätgotische Kanzel nicht erhalten geblieben ist. Er beschreibt das Innere der Kirche im Detail, was weitestgehend identisch ist mit den Beschreibungen des seinerzeitigen Pastor Decker. Er vergleicht die Kirche mit Bauten in Bosau und Schlagsdorf. 1146 wurde die St. Jacobi Kirche in Bornhöved geweiht.


Quelle: C. Degen
Die Kirche in Leezen war vermutlich die einzige Pfarrkirche im Gau Faldera, neben der Stiftskirche in Novum Monasterium, deren Bau 1126 begann. Die einzigen weiteren Vizelin-Kirchen in der Region waren Oldesloe (1150) und Bornhöved (1149). Unsere Kirche hat in den unruhigen Zeiten auch als Schutz gegen marodierende Wagriern auch als Flucht- und Wehrkirche gedient. Im 12. Jahrhundert wurde sie durch Umbauten unter Verwendung von Ziegelsteinen vergrößert. Beim Abriss wurden Ziegel gefunden, die aus der Ziegelherstellung der Lübecker Petri-Kirche (1174-1226) stammen. Es gibt eine Frage, auf die ich keine schlüssige Antwort finde. Warum sind alle Vizelin-Kirchen, auch die beiden oben genannten, einem Heiligen geweiht und unsere Kirche nicht? Vielleicht weil unsere Kirche schon lange vor Vizelin gebaut und geweiht wurde?

Latzinghe, Latzinge, Lescinge, Letcingge, Leezink, Leezen
Seit Mitte des 11. Jahrhunderts gab es immer wieder Grenzgefechte entlang der Trave und Schwentine. Daraus folgten dauerhafte Landnahmen der Slawen und sie gründeten Siedlungen westlich der Trave, während es keine Hinweise gibt, die über neue sächsische Siedlungen östlich des Limes berichten. Es gibt keine verlässliche Information ob die Gründungen friedlich verliefen oder Resultat kriegerischer Besetzung und Unterdrückung waren.
Wie verlief die Geschichte in Leezen? Die päpstliche Bulle von 1199 und das kaiserliche Privileg von 1192 sind Dokumente, die das Dorf historisch dokumentieren. Dass Leezen schon vor dieser Zeit gegründet wurde ist durch die Geschichtsforschung belegt. Wann Leezen tatsächlich gegründet wurde ist durch offizielle Dokumente nicht zu bestimmen. Um das hohe Alter unseres Dorfes zu würdigen wurde ein 800 jähriges Jubiläum basierend auf der päpstlichen Bulle 1999 gefeiert. In diesem Dokument, das alle für das Kloster Segeberg Abgaben pflichtige Dörfer erwähnt, ist auch Leezen genannt. Das Segeberger Kloster wurde von Kaiser Lothar und Papst Konrad bei der Gründung 1134 großzügig mit Lehen beschenkt. Im Hamburger Urkundenbuch liegen weitere Dokumente dazu vor. Diese Urkunden, im Prinzip diplomatische Briefe, wurden als Privilegien bezeichnet. Die Urkunde 152 (1192) von Heinrich VI. bestätigt die von Kaiser Lothar und Papst Konrad 1134 gemachten Geschenke an das Kloster Segeberg.

Leezen wurde demzufolge schon 1134 urkundlich erwähnt. Einige Einzelheiten sind jedoch überraschend. Es ist vor allem die Schreibweise der Dörfer, die von der von 1199 abweicht. Hier wird Leezen als Lautzen geschrieben. Der Historiker C. Schirren, bezeichnet 1876 in seinem Buch „Beiträge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsquellen“ viele offizielle Dokumente als unzuverlässig und beschreibt typische Mängel dieser Zeit. Es war das Sprachengewirr und Kompetenzgerangel in den Kanzleien und es wurde auch gefälscht und gelogen. Es entstanden Fehler beim Kopieren von Urkunden. Beim Vergleich der Darstellung identischer Ereignissse in verschieden Urkunden sind eklatante Unterschiede zu erkennen. Das betrifft auch die im Original lateinisch verfassten Inhalte, z.B Ortsnamen, und auch Nachträge und Korrekturen. Latein war seit Karl d. Gr. Amtssprache in ganz Europa. Die Sprache wurde jedoch ausschließlich von Wissenschaftlern und Klerikern beherrscht. 90 % der Bevölkerung war des Lesens und Schreibens unkundig. Die Ortsnamen wurden sehr oft mündlich weitergegeben. Das führte zwangsweise zu Fehlern. Erst ab dem 14. Jahrhundert wurden Dokumente in Mittel-Niederdeutsch verfasst.
Es ist dokumentiert, dass Leezen vor der Gründung Segebergs 1134 bereits als Gemeinde mit einer Kirche bestand. Es ist jedoch überraschend, dass sie zu der Zeit die einzige Kirche im Gau Farland war. Das beantwortet aber noch nicht die Frage nach dem Alter des Dorfes. An weiteren dokumentarischen Beweisen steht bisher nichts zur Verfügung. Ein vielgenutztes Werkzeug der Sprachforschung hilft uns die Zeit der Ortsgründung zurück zu den Quellen zu verfolgen. Etymologie erforscht Ursprung, Herkunft und Bedeutung von Wortbildungen. Auskunft finden wir auch in Deutschen Ortsnamenbüchern, bei Historikern und Sprachforschern.

Die Abbildung zeigt uns die drei Gaue von Nordelbien plus Faldera und das slawische Wagrien und Polabien aus der Zeit vor der Errichtung der „Siegesburg“ auf dem Alberg (heute Kalkberg), somit vor 1134. Bemerkenswert ist, dass der Limes und die sächsischen Gaugrenzen nicht identisch dargestellt sind und sich slawische Siedlungen bereits vor dem Bau der Siegesburg auf sächsischem Gebiet befinden. Der Limes war zwar als vertragliche Grenzlinie angelegt und von Adam von Bremen 1075 beschrieben, hatte aber auf jeder Seite ein manchmal mehr als 20 Kilometer breites, schwer zugängliches, Wald- und Moorgebiet links und rechts der Trave, das die Slawen und Holsten und Stormarner auf ihrem Gebiet zurückhalten sollte. Die Holsten nannten ihren Teil des Niemandslandes „ Gau Faldera“. Der Segeberger Forst und der Sachsenwald sind Reste dieses Grenzgebiets. Faldera war im Grunde genommen ein viertes kaum bewohntes Gau, das bis zur Trave reichte. Zur Grenzaufsicht dienten auf beiden Seiten Burgen. Mit dem Grenzschutz waren seit Otto d. Gr. die Billunger Herzöge betraut. Dazu stand eine wahrscheinlich berittene Truppe zur Verfügung, überliefert als “virtus holzatorum“. Die Leezener Burg war möglicherweise Teil dieses Verteidigungssystems. So, dass die sächsischen und wendischen Dörfer gemeinsam mit Latzinghe nicht vollkommen schutzlos gegen Überfälle gewesen waren. Es ist wahrscheinlich, dass die wendischen Nachbardörfer bereits christianisiert waren.
Zu diesen westlich der Trave befindlichen slawischen Siedlungen gehören Schwissel und Högersdorf. Im Gegensatz zu den Slawen verstanden die Germanen den Limesstreifen als Niemandsland. Sie gründeten keine neuen Siedlungen östlich der Trave. Die genannten Dörfer trugen ursprünglich slawische und auch sächsische Namen, während für Leezen nur ein alt-sächsischer Name bekannt ist. Bemerkenswerterweise werden in der Stiftungsurkunde für das Segeberger Kloster vom 17. März 1137 sächsische Namen für die slawischen Orte genannt: z.B. hageristhorpp, alt-sächsisch für slawisch cusalina und alt-sächsisch Zuwissel für slawisch zuizele.
Während die Franken in der Karolingischen Zeit im 9. Jahrhundert nur wenige und nicht ständig bewohnte Verteidigungsanlagen am Limes gebaut hatten errichteten die Slawen mehrere Burgen entlang des östlichen Ufers der Trave. Die Wenden begannen mit ihrer grenzüberschreitenden Landnahme westlich der Trave bereits um 1050. Das Siedlungsgebiet der Holsaten innerhalb ihrer Gaugrenzen beginnt, durch Burgen geschützt, einige zehn Kilometer weiter westlich, etwa entlang des Ochsenwegs. Die Dörfer Mözen (Mo(y)zinge) und Leezen (Latzinghe) liegen außerhalb des durch Burgen geschützten Siedlungsgebiets. Als alt-sächsische Gründungen existierten sie dort möglicherweise schon in der Zeit der Einwanderung der Sachsen, die im 5. Jahrhundert begann. Ob die Einwohner von Leezen und den anderen alt-sächsischen Dörfern mit den Slawen einvernehmlich zusammen lebten, sich duldeten oder gar vertrieben wurden, wie einige Historiker vermuten, lässt sich nicht genau ermitteln.

Die Eintragung im Deutschen Ortsnamenbuch gibt uns einen Hinweis. In den ersten urkundlichen Erwähnungen wurde unser Dorf Latzinghe genannt. Der Ortsname ist unzweifelhaft alt-sächsischen Ursprungs und setzt sich aus zwei Wortstämmen zusammen: -Latz und -inghe. Im Deutschen Ortsnamenbuch von 1868 und von Etymologen wird beschrieben, dass das Suffix -ing für Siedlung, Platz, aber auch Heimstatt steht. Das Präfix -latz deutet auf mehre Möglichkeiten hin. Er könnte Gewässer bedeuten aber auch der Name einer Sippe oder Familie sein. Die Endungen -ing und inghe wurden in der Namensgebung für Siedlungen in Alt-Sachsen zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert verwendet. Sie gehen zurück auf das Alt-Germanische -inga (Haus). Damit stellen wir fest, dass unser Dorf und damit vielleicht auch die Wallburg im See eine frühe alt-sächsische Gründung ist. Die Wagrier hatten sich bevorzugt an der Ostseeküste nieder gelassen und die Oldenburg errichtet. Es wurden auch einige Befestigungen entlang der Trave gebaut. Die Region war zum Ende der Völkerwanderung nach Wegzug der Angelsachsen und Sweben sehr dünn besiedelt und mit ihren dichten Wäldern und Mooren nur schwer zugänglich.
Chronisten gliedern Leezen in drei Ortsteile (Budorp, Leezen, Camp), was die Frage aufwirft, wann und wie die Aufteilung entschieden wurde. Es erscheint mir ungewöhnlich, dass ein so kleiner Ort drei Ortsteile hat. Budorp wird in unseren Orts-Chroniken als der älteste Teil angesehen. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, die allesamt nicht überzeugend sind. Die Kirche steht in dem Orttsteil der Leezen (Latzinghe) genannt wird. Warum nicht auf dem Budorp? Zwischen beiden Ortsteilen klafft eine deutliche Lücke. Wenn Budorp der älteste Teil von Leezen wäre, sollte man die Bestimmung des Namens über die alt-sächsische Sprache vornehmen können. Ein alt-sächsischer Name für Budorp ist nicht dokumentiert. Es findet sich auch kein Eintrag im Deutschen Ortsnamenbuch. Ein sehr umfangreiches alt-sächsisch-neuhochdeutsches Wörterbuch liefert uns einige passende Begriffe und ihre Bedeutung;
Bu- Bau, Heim; Bur– Bauer; Thorp– Dorf; Buland– Bauland, Feld; Kamp- Kampf, Feld
Quelle: G.Kobler
Auch der Begriff -dorp existiert im alt-sächsischen nicht. Der Name muss nach der Gründung Leezens entstanden sein, als sich in der Sprachentwicklung Niederdeutsch etabliert hatte. Am Ende des 12. Jahrhunderts begann der Übergang von Alt-sächsisch zu Mittel-Niederdeutsch. Somit macht der Name „Budorp-Bauerndorf“ Sinn. Vorstellbar wäre auch eine Kombination mit dem Bezug „Heim oder Haus“. Latzinghe deutet auf eine ursprünglich kleine Wohneinheit hin, vielleicht für eine Sippe oder ein Einzelgehöft. Eine größere Siedlung würde das Suffix – thorp getragen haben. Dass in den Urkunden Leezen mit dem Alt-sächsischen Namen bezeichnet wird bedeutet schließlich, dass die Namensgebung weit zurückliegen muss. Die erste Abwandlung des Ortsnamens erfolgte 1219 in Lescinghe.

Dieser militärische, detailliert kartographierte Plan von 1880 bildet das Prinzip der Dorfanlage sehr deutlich ab und zeigt, die Siedlung um die Kirche im Zentrum, während Budorp sich eher als Anhang darstellt. Zu Bedenken ist auch, dass die Anlagen um die Kirche um zwei Meter erhöht stehen und damit leichter zu verteidigen und geschützt gegen Hochwasser waren und sich als Erstbesiedlung für eine Familie oder Sippe angeboten haben. Schließlich bilden sie auch das Zentrum des Ortes und liegen näher am See. Das Gebiet um die Kirche liegt räumlich deutlich getrennt vom Budorp. Es ist daher nicht auszuschließen, dass „Budorp“ zur Abgrenzung und zur Namensgebung für eine bäuerliche, nachbarschaftliche Neu-Gründung im Zuge der nach-wendischen Kolonisation in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts diente. Dafür spricht auch, dass es zwei Dorfanger gibt.
Kamp schließt sich laut Erdbuch von 1776 unmittelbar nach Südosten an. Der Name ist dem Lateinischen entlehnt (Campus) und bedeutet unter anderem Acker oder Wiese. Der Begriff wurde im 11. Jahrhundert oft verwendet, stammt daher aus einer frühen Phase des Dorfes. Der Kamp wurde wechselweise als Acker, aber auch als Weide verwendet. Typisch für einen Kamp war, dass er zehnt- und stoppelfrei war und auch nicht dem Flurzwang unterlag. Im „Segeberger Erdtbuch von 1776“ findet sich in Leezen in der langen Liste der Flurstücke kein Hinweis zu diesem Namen. Es gibt aber eine Eintragung in einer separaten Abteilung. Dort wird Kamp aufgeführt mit einem Hinweis auf das Kirchenbuch, wird als „volkstümlich“ beschrieben und liegt südlich und östlich der Kirche. Das lässt den Schluss zu, dass es sich um eine Gebietsbezeichnung handelt für das Stück Land am Seeufer zwischen der Landstraße (B432), der Leezener Au und Neversdorfer Straße und kein bestimmtes Eigentum bezeichnet. Vielleicht war es bis zur Verkoppelung 1776 eine Allmende. Schmiedekamp ist wohl Teil des ursprünglichen mittelalterlichen Kamp.
Wem war Latzinghe damals abgabenpflichtig? Burg oder Kloster? Das Segeberger Erdbuch von 1665 gibt Auskunft. Dort heißt es:
„Ein richtiges Erdtbuch aller des Ambts Segeberg Jährliche Einkünfte….
Kirchspiell Leetzen: Das Dorf Leetzen, darin liegt eine Kirche……Sonst wohnen darin 7 Hufner….., so theils Königlich, theils Clösterlich gewesen, als…..“
Ein anderer Eintrag lautet:
„Die ümb der Stadt Segeberg liegende Königl. Ländereien, so zur Burch gehörig gewest, als: Die Leezinger Wische ………“
„Die vor diesem zum Closter Segeberg gelegenen Ländereien sind follgende als:
An Seehen sind vorhanden:
1. Der große Sehe bey Segeberg….
2. Der Leezinger Sehe ist verhauret mit der Aalkiste vor 40 RT.
3. ………“
Leezen musste zur Zeit der Gründung von Segeberg sowohl an die Burg, (den Herzog von Sachsen), als auch an das Kloster Abgaben entrichten.
Der Burgwall auf der Insel
Über die Burganlage auf der Insel im See sind nur wenige Fakten bekannt. Wann und warum wurde die Wallanlage auf der Insel errichtet und warum gibt es über die Leezener Burg so wenig Information über Ursprung und Funktion und stattdessen überlieferte Geschichten und sagen aus späterer Zeit? Es gab in der karolingischen Zeit auf holsteinischer Seite in unserer Nähe am Limes nur eine Burg, die Nütschauer Schanze. Als die Siegesburg in Segeberg 1134 errichtet wurde, gab es gemäß der Karte bereits die Burg in Leezen, möglicherweise schon seit der Zeit der Karolinger.


Zunächst wurde das von Karl dem Großen eingeführte Grenzregime von beiden Seiten respektiert. Das führte zum Bau verschiedener Burganlagen auf beiden Seiten zwischen Elbe und Schlei. Es waren durchweg Wallanlagen mit 80 -100 Meter Durchmesser. Die Grenzanlagen an der Elbe und Bille waren ständig umkämpft, da hier die nach Norden und Westen drängenden Slawen mit den Germanen zusammenstießen. Die Stormarner Hammaburg wurde mehrfach zerstört und wieder errichtet. Die wichtigste Verteidigungsburg der Sachsen der karolingischen Zeit an der Mitteltrave, war seit 840 die Nütschauer Schanze. Sie war nicht ständig besetzt, konnte daher leichte Beute der Slawen werden und wurde wiederstandlos im letzten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts von Slawen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Stattdessen vergrößerten die Wagrier jenseits der Trave die Alt-Fresenburg (nahe Oldesloe) und trieben den Siedlungsbau westlich der Trave voran. Das geschah bereits bevor Segeberg gegründet wurde. Weitere slawische Burgen in unserer Nähe standen in Stipsdorf, Strenglin, Warder und älteste und kleinste nahe Segeberg/Gladebrügge. Die ersten großen Landeroberungen der Slawen fanden in einer sehr gewaltsamen, expansiven Phase statt. 1066 begann mit der vollständigen Zerstörung von Haithabu/Sliasvic durch Kruto eine blutige Eroberungsphase. Seine Hauptstadt gründete er als Luibice nahe dem heutigen Lübeck. Er brachte das sehr dünn besiedelte Gau Farland komplett unter seine Kontrolle. Was hieß das für die slawischen Dörfer Högersdorf und Schwissel in unmittelbarer Nachbarschaft zu den sächsischen Dörfern? Waren sie bereits christianisiert und integriert? Die Holsaten hatten sich hinter ihre Gaugrenzen am Ochsenweg zurückgezogen und das Gau Farland als Niemandsland hinterlassen. Ihre Burgen liegen alle innerhalb, westlich der Gaugrenzen. Die alt-sächsischen Gründungen (Leezen und Mözen) überließen sie offensichtlich sich selbst. Über das Schicksal dieser drei Dörfer im Zusammenleben mit den slawischen Eindringlingen wissen wir nichts Überliefertes. Georg Waitz gibt uns 1851 in seinem Buch über unsere Geschichte eine Einschätzung der Situation im Jahr 1066:

In diesem Sinne besteht die Möglichkeit, dass die altsächsischen Dörfer und vielleicht auch die wendischen Nachbarn weniger betroffen waren, weil Kruto sich besonders auf Stormarn konzentrierte. Es ist denkbar, dass die Kirche in dieser Zeit als Fluchtburg gedient hat. 1093 wurde Kruto ermordet und gemäßigte christliche wagrische Führer übernahmen die Macht.
Die Graphik von H. Fiege bezeichnet Leezen als slawische Burg. Es ist eher wahrscheinlich, dass sie bereits bei der ursprünglichen Landnahme durch eingewanderte Sachsen gegründet wurde. Eine andere Graphik (Kersten und Hucke) scheint das zu bestätigen, wie auch spätere Grabungen. Sie liegt dicht vor dem Leezener Ufer und Neversdorf gab es noch nicht. Sie hatte eine fast uneinnehmbare Position und bot als starker Vorposten sicheren Schutz. 1966 wurde durch Ausgrabungen des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte die Anlage in Form eines Ringwalls identifiziert. Keramikfunde wurden in das 11./12. Jahrhundert datiert. Es fand sich aber kein nachweisbarer Ursprung. Die archäologische Untersuchung benennt die Scherbenfunde zwar als slawisch, jedoch „mitgebracht“. Man fand auch eine frühgeschichtliche Messerschneide, ein bronzenes Teil von einem Henkel und Reste eines Holzeimers. Eine dendrologisch chronologische Analyse könnte Klarheit verschaffen, wann der Ringwall errichtet wurde. Die Funde deuten auf das frühe Mittelalter. Sie war möglicherweise ursprünglich als Fluchtburg für die umliegenden Dörfer gedacht. Es ist auch denkbar, dass die Bewohner der slawischen Dörfer in der Nachbarschaft sich schon frühzeitig zum Christentum bekannten, zumindest aber friedlich mit den Holsten zusammen lebten und die Burg gemeinsam nutzten. Das Kloster Segeberg wurde in Mitten einer kriegerischen Situation in das slawische Dorf Cusalina umgesiedelt, was sicherlich ein christliches Umfeld voraussetzte. Wenn eine friedliche Koexistenz zwischen Holsaten und Wenden schon länger bestanden hat, gab es kein Schutzbedürfnis mehr und die Burg hatte ihren Nutzen verloren. In jedem Fall hat die Burg spätestens ab 1140 nach der Unterwerfung der Wagrier keine Funktion mehr. Es gab um 1100 keine ständig bewohnte sächsische Burg mehr direkt am Limes.
Unsere Nachbardörfer
Erste sächsische und slawische urkundliche Erwähnungen:
Bebensee: 1216 benense
Fredesdorf: 1192 ricfredestorppe, 1216 richfrethestorpe, vermutlich dann eine Neugründung anstelle des ursprünglichen Dorfes. 1249 Volkerikestorp, volkerik, fulkerich
Högersdorf: 1137 hageristorpp, cusalina (slaw.)1199 hogherestorp, Hotgersdorf
Krems: 1249 kremptze (slaw. Hügel im Moor), crembze
Kükels: 1305 ky-elze (slaw.)
Mözen: 1137 moyzen, moitzing, moitling, 1139 mozinke, , 1150 moycene, 1192 moytzen, 1199 moytzinge, motsinke, 1226 moytzinge
Neversdorf: Keine urkundliche Erwähnung, auch nicht im Ortsnamenbuch
Niendorf: 1216 Nigendorpe
Schwissel: 1150, szwitole (slaw.), zuwissel, 1199 suizele, 1216 switzele; gilt als eine der ergiebigsten und wertvollsten vorgeschichtlichen Fundstätten in Holstein.
Quelle: P. Dohm
Im unmittelbaren Einzugsbereich der Leezener Burg befanden sich Leezen, Mözen vielleicht auch Bebensee und in einiger Entfernung Högersdorf und Schwissel. Ein Wendepunkt kam 1134 mit dem Bau der Siegesburg und der darauf folgenden endgültigen Niederschlagung der Slawen in Ostholstein. Die Besiedlung links und rechts der Trave beschleunigte sich. (Krems, Kükels, Niendorf). Der Limes wurde eine weitgehend befriedete Gau- und Sprachgrenze zwischen Holstein/ Stormarn und Ostholstein/Lauenburg. Vizelin begann von Segeberg ausgehend die Missionstätigkeit in Ostholstein. Die einzigen Alt-Gründungen in unserer Nähe sind wohl Högersdorf, Mözen, Leezen, Schwissel, vielleicht auch Bebensee. Alle anderen Ortschaften sind nach der Kolonisierung Ostholsteins entstanden.
Das Ende der Wenden in Holstein
Norddeutschland war seit der Völkerwanderung chronisch unterbevölkert. Vom 8. bis 11. Jahrhundert nahm die Besiedlung durch die Gründung neuer Dörfer und Städte zu. 1138 wird die 1134 errichtete Siegesburg in Segeberg von slawischen Truppen aus Alt-Lübeck (Liubice) erobert und teilweise zerstört. Die Rache der Holsaten kam dann schnell und gründlich. Es war sicherlich auch eine Reaktion auf die seit Jahrzehnten andauerten gewaltsamen Eroberungen und Landnahmen der Slawen westlich des Limes. Im Winter 1138/1139 besiegten die Holsaten die Slawen vernichtend. Die Historiker sind sich einig, dass es ein brutaler und gründlicher Schlag war. Die meisten Dörfer der Wagrier und Polaben wurden zerstört. Ihre Felder wurden verwüstet. Die Bewohner wurden aus ihrem Siedlungsgebiet vertrieben, entrechtet und bis an die Ostsee gedrängt. 600 Familien wanderten aus in den Harz. Man wies den Verbliebenen einen schmalen Streifen um Starigard (Oldenburg) an der Küste und die Insel Fehmarn zu. Besonders hart war, dass den verbliebenen Slawen in Ostholstein zu Beginn Landeigentum verboten wurde. Allerdings wurde ihnen zuweilen genehmigt sich neben ihrem ehemaligen Besitztum, das nun von „Immigranten“ aus Sachsen und Friesland bewohnt war, niederzulassen. Sie waren aber von diesen Dörfern abhängig. Ihnen wurde das sächsische Recht verwehrt und sie waren nach slawischem Recht vogelfrei. Sie konnten jederzeit vertrieben werden. Ein nicht eingeplantes, folgenschweres Ergebnis der Slawenvertreibung war, dass nun ein zum Herzogtum Sachsen gehörendes Ostholstein mit vielen leeren Gehöften und unbestellten Äckern daniederlag und Versorgungsprobleme für die Einwohner mit sich brachte. Graf Adolf der II., Herzog von Sachsen, ergriff die Initiative und bot ab 1143 umzugswilligen Bauern aus seinem sächsischen Herrschaftsgebiet, Friesland und Holland Land als „Geschenk“ an. Die Hoffnung des Landesfürsten, dass holsteinische und Stormarner Bauern die Lücken schließen würden erfüllte sich nicht wie gewünscht. Holsten und Stormarner trauten der „Einladung“ nicht und blieben lieber westlich der Trave. Es geschah auch, dass Umsiedler hier hängen blieben und nicht ins Wagrierland weiterzogen. Die Siegesburg wurde 1147 unter erzwungener Mithilfe der Wagrier wieder aufgebaut und Lübeck wurde unweit Liubice gegründet. Graf Adolf schickte „Lokatoren“ nach Westfalen, Niedersachsen, Friesland und Holland um Bauern anzuwerben. Helmold von Bosau schreibt in seiner Slawenchronik (Chronica Slavorum):
„Daraufhin brach eine zahllose Menge aus verschiedenen Stämmen auf, nahm Familien und Habe mit und kam zu Graf Adolf nach Wagrien, um das versprochene Land in Besitz zu nehmen. Und zwar erhielten zuerst die Holsten Wohnsitze in dem am besten geschützten Gebiet westlich Segeberg, an der Trave, in der Ebene Schwentinefeld und alles, was sich von der Schwale bis zum Grimmelsberg und zum Plöner See erstreckt. Das Darguner Land ( Ahrensbök) besiedelten die Westfalen, das Eutiner die Holländer und Süsel die Friesen. Das Plöner Land aber blieb noch unbewohnt. Oldenburg und Lütjenburg sowie die anderen Küstengegenden ließ er von den Slawen besiedeln, und sie wurden ihm zinspflichtig.“



Der „Bauermeister“ mit dem Strohhut erhält vom Lehnsherrn eine Urkunde mit seinen Rechten. Er wird zum Dorf-Voigt bestimmt, zum Ortsvorsteher. Viele neue Dörfer sind nach der Unterwerfung der Wagrier ab 1143 im heutigen Ostholstein so entstanden. Im Unterschied dazu ist die Gründung Leezens lange davor geschehen, als Land durch freie Einwanderer ohne Lehnsherrn in Besitz genommen und urbar gemacht wurde.
Quelle: Sachsenspiegel,1304
Schlussfolgerungen
Als die Leezener Chroniken verfasst und veröffentlicht wurden waren viele Quellen nicht zugänglich. Der Schwerpunkt war die reine Ortsgeschichte. Zum besseren Verständnis lohnt sich auch ein Blick auf die Geschichte unserer Region. In Online-Archiven findet man viele Original- und Facsimile- Buchausgaben namhafter Historiker in Bibliotheken bekannter Universitäten weltweit, auch in der Library of Congress in Washington. Diese zusätzlichen Informationen ermöglichen Blickweisen auf die Entstehung und Entwicklung unserer Region und darin eingebunden unser Dorf. Die Geschichte Leezens ist Teil der historischen Entwicklung in Holstein und Ostholstein seit dem frühen Mittelalter. Leezen gilt als eines der ältesten (erhaltenen) Dörfer nördlich der Elbe in den heutigen Landkreisen Stormarn und Segeberg. Eine frühe Besiedelung des Raumes an der Leezener Au und am See in vorgeschichtlicher Zeit ist durch Grabungsfunde belegt. Die Siedlungsstätten befanden sich auf den höher gelegenen sandigen Plätzen. Ob Leezen ständig besiedelt war ist unbekannt.
935 entsteht die Billunger Mark. Wagrier begannen nun vermehrt nach Ostholstein einzuwandern. Die Burg Starigard (Oldenburg) wurde ab 790 errichtet und danach wurde die Gegend um Plön besiedelt. Der von Karl geschaffene Limes Saxoniae versprach ab 809 für eine gewisse Zeit Frieden in den drei nordelbischen Gauen, Wagrien und Dänemark. Es wurden im gesamten Nordelbien und Wagrien Burgen gebaut. Das beschleunigte die Immigration und die Gründung von Ortschaften, die zumeist in der Nähe von Burgen erfolgte. Die Franken übernahmen die Macht in Nordelbien.
1106 gilt als Gründungsjahr der Grafschaft Holstein durch Lothar von Supplingenburg (auch Supplinburg), dem späteren Kaiser Lothar III (1133-1137). Mit der Niederlage der Slawen 1139 war ein großes Herzogtum Sachsen entstanden. Das heutige Ostholstein war nach dem brutalen Überfall der Holsten weitgehend verwüstet, die Einwohner waren vertrieben oder enteignet und die Äcker lagen brach. Der Lehnsherr, Graf Adolph, holte neue Siedler aus Westfalen, Friesland und Holland. Sie lebten und siedelten mit den verblieben Slawen in Nachbarschaft. Es entstanden gleichnamige Siedlungen, die durch ein Prefix, (Groß/Klein, Alt/Neu, I/II) unterscheidbar waren. Es geschah auch, dass Neuankömmlinge nicht bis ins Wagrierland zogen sondern blieben bei oder in der Nähe der Holsaten und Stormarner entlang der Trave.
In diesen zeitlichen Abschnitt fällt das Wirken Vizelins, der ab 1130 in Holstein und Wagrien missionierte und eine Reihe von Kirchenbauten in Angriff nahm. Unsere alte seit 1870 nicht mehr bestehende Kirche wurde zu Vizelins Zeit umgebaut und vergrößert. Dass in Leezen eine Kirche vor 1130 stand ist sicher, weil dokumentiert ist, dass das „Kirchspiell Latzinghe“ mit Kirche und Dorf von Kaiser und Papst als Lehen an das Kloster Segeberg, den neuen Bischhofssitz, gegeben wurde. Die Gründung von Kloster und Ort Segeberg 1134 und der Bau der Siegesburg durch Kaiser Lothar wurden zu einschneidenden Ereignissen auch für Leezen. Pastor Decker beschreibt 1870 den Abriss der alten Leezener Kirche in seinem Buch „Neubau der Leezener Kirche“. Er berichtet auch über eine Fensterscheibe mit einer Inschrift, die auf Papst Gregeor VII (1075-1083) hinweist. Decker schreibt, dass es zuvor eine kleinere, wehrhafte Kapelle zum Schutz vor marodierenden Wagriern gegeben hat, die in mehreren Schritten ausgebaut wurde. Es lässt sich in den Abbildungen von 1870 gut zu erkennen wie der östliche, kleinere Teil nach Westen vergrößert wurde und der Kirchturm als separater Bau später dazu kam. Das mag auch erklären warum die Kirche keine Apsis hat. Ein Hinweis auf ein kleines Kirchlein taucht auch in einer anderen Quelle auf.
Die Wenden führten ab 1066 massiv Überfälle auf Holstein und Stormarn durch. Ab 1071 herrschten sie unter der Führung von Herzog Kruto über ganz Holstein und Stormarn. Die Darstellung der sächsischen Sprachgrenze in der obigen Grafik weist darauf hin, dass alt-sächsische Orte (vermutlich Leezen, Mözen) dicht am Limes und zugleich dicht an der slawischen Sprachgrenze liegen, umgeben von slawischen Dörfern. Die Karte suggeriert zwar, dass in Leezen alt-sächsisch gesprochen wurde, zumal auch kein slawischer Name von Leezen und Mözen bekannt ist, sagt aber nichts aus, wie die herrschaftlichen Verhältnisse waren und wie man mit den Slawen zusammenlebte. Es spricht viel dafür, dass vor 1100 unsere slawischen Nachbardörfer bereits christianisiert waren. Es finden sich Hinweise auf eine friedvolle Koexsistenz, beschrieben 1854 von J.F.A. Mahn.
„Der dritte Stamm der Slawen, die Wenden, besetzte alle Länder an den Ufern der Ostsee entlang, dehnte sich bis in das jetzige Holstein aus und wurde hier Nachbar der Nordalbingischen Saxen. Nicht aber eroberungssüchtig und kriegslustig, wie die andern Slawischen und fremden Völker, treten die Wenden auf, sondern in kleinen Abtheilungen schlichen sie sich gleichsam allmählich in die neuen Wohnsitze ein, ja sie erbaten sich, wo sie noch Germanische Einwohner vorfanden, friedliche Aufnahme.“
Quelle: J.F.A Mahn
Slawische Siedlungen in Leezens Nachbarschaft (z.B. Schwissel, Högersdorf) haben schon vor der Gründung Segebergs bestanden. Andere, z.B. Krems und Kükels als slawische Gründungen erst danach. Für die Annahme eines friedlichen Zusammenlebens spricht auch, dass das slawische Gebiet gegenüber der Trave schwer zugänglich, kaum besiedelt und wenig einladend war, so dass Slawen sich auch jenseits der Trave friedlich angesiedelt haben konnten. Die ursprünglichen Siedlungsräume der Wagrier waren die Seen um Plön, Starigard (Oldenburg) und an der Elbe die Polaben. Segeberg, Traventhal, Gladebrügge, Oldesloe, alle auf slawischem Gebiet, waren noch nicht gegründet. Es gab nur die kleine nicht bewohnte Grabenburg (Ohlenborg) gegenüber Högersdorf am Travebogen nahe zu Segeberg und die Alt-Fresenburg gegenüber Nütschau. Eine dendrochronologische Datierung gefundener Palisaden gibt für die Ohlenburg die Zeit 894 bis 897 an.
Der Zuzug in den Norden wurde in der karolingischen Zeit von der kaiserlichen Residenz in Bardowik kontrolliert. Dort wurden alle Migranten „empfangen“ und die Trekks wurden verteilt. Die Slawen wurden über die Elbe nach Nordosten und die Sachsen nach Nordwesten dirigiert. Die Zuwanderung kann man sich durchaus wie die Besiedelung des amerikanischen Westens vorstellen. Die Menschen kamen in Trekks, nahmen Land wo es ihnen gefiel oder ihnen zugewiesen wurde, machten es urbar, rodeten die Wälder und errichteten Siedlungen. Sie benannten ihre Siedlungen oft nach dem Trekkführer oder dem Sippenoberhaupt. Leezen mit seiner Burg könnte zu karolingischer Zeit entstanden sein. Die Alt-Sachsen begannen Holstein und Stormarn ab dem 5. Jahrhundert zu besiedeln. Die Siedlungen waren zu Beginn keine großen Dörfer. Es waren teilweise Einzelgehöfte von Familien und Sippen, oft in Burgnähe. Sie konnten in der Gründungsphase bedenkenlos in der dünn besiedelten Region attraktive und fruchtbare Plätze an Gewässern wählen (Leezener See, Mözener See, Trave, Auen).
Viele der früh gegründeten Siedlungen wurden wieder aufgegeben oder unter anderem Namen weiter geführt. Einige noch heute existierende Ortsnamen sind Bornhöved, Ulzburg, Wittorf, Einfeld, Hitzhusen, Kaaks, Farland. Die „Leezener“ siedelten an der schon existierenden Fern-Handelsroute, einem Zweig des Ochsenwegs zwischen Skandinavien-Neumünster-Hamburg, sowie dem Elbe/Nordsee-Itzehoe-Trave-Ostsee Handelsweg. Auch das spricht für eine frühe Besiedelung.
Ein gutes Argument für ein dauerhaftes, nachbarschaftliches Nebeneinander von Holsten und Wagriern ist die Tatsache, dass die weit und breit einzige christliche Pfarrkirche in Leezen die gewaltsamen Wirren überstanden hat. Die slawischen Dörfer trugen in offiziellen lateinisch geschriebenen Urkunden 1134 alt-sächsische neben ihren slawischen Namen. Die slawische Sprache verschwand in Ostholstein dann allmählich durch Assimilation deren Einwohner. Ostholstein wurde deutsch.
Es ist gerechtfertigt zu wiederholen, was unsere Chronisten schon festgestellt haben; Leezen gehört zu den ältesten Siedlungen in Nordelbien. Man kann angesichts des zeitlichen Szenarios und der regionalen Geschichtsereignisse auch die Frage stellen; Was spricht dagegen, dass Leezen vor dem Jahr 1000 gegründet wurde?
Quellenverzeichnis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrien
https://de.wikipedia.org/wiki/Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamp
www.geschichte-s-h.de Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
www.deutsche-digitale-bibliothek.de
www.gemeindearchiv-leezen-sh.de
Gerhard Köhler, 2014, „Altsächsisches Wörterbuch“
Agathe Lasch, 1914, Mittel-Niederdeutsche Grammatik, Seite 4 ff
Hamburger Urkundenbuch Nr. 152, 156
Lübecker Urkundenbuch
Manfred Niemeyer, „Deutsches Ortsnamenbuch“, 2011
Ernst Förstemann, „Die Deutschen Ortsnamen“, 1863
J.F.A. Mahn, 1854 „Einwanderung der Wenden“
Hartwig Fiege 1979, „Wie Ostholstein und Lauenburg deutsch wurden“, Seiten 13, 37
Otto Brandt 1949, „Geschichte Schleswig Holsteins“ Seite 35-42, 52 ff
Hans-Werner Rickert, 2002, „Groß-Niendorf Geschichte, Geschichten und Ansichten eines Dorfes“ Seite 23 ff
Richard Haupt, 1884, „Die Vizelinskirchen“ Seite 16 ff
Schirren, 1876, „Beiträge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsquellen“ Seite 213 ff
Horst Brügmann 1968 , „Siedlungsgeografische Entwicklung von Leezen“ Seite 14 ff
Wilhelm Holtz, 1967 , „Ortschronik Leezen- Flurnamen“
Pastor August Decker 1871, „Neubau der Leezener Kirche“ Seite 2 ff
Georg Waitz, 1851 „Schleswig-Holsteins Geschichte“, Seite 50 ff
Christian August Volquardsen, 1907, „Aus schleswig-holsteinischer Geschichte“ Seite 4 ff
Segeberger Zeitung 1980, Klaus J. Groth „Doppelte Dörfer der Deutschen und Slawen“
Paul Dohm, 1908 ,“Holsteinische Ortsnamen, die ältesten urkundlichen…….“ Seiten 16, 35, 36, 38,45,65,183: Anhang: 136
Christian Degen 1995, „Schleswig Holstein-Eine Landesgeschichte“, Seite 29
Michael Müller-Witte,1991 „Starigard/Oldenburg“ Seite 60 f